Ethische IT: Von der Fußnote zur Führungsaufgabe

1. Einleitung: Warum Ethik in der IT nicht nur eine Fußnote sein darf

Wenn wir heute über Digitalisierung sprechen, geht es fast immer um Geschwindigkeit, Automatisierung, diverse Kosten- und Lizenz-Optimierungen, kurz gesagt Effizienz thront über Allem. Was dabei gern unter den Tisch fällt: die ethische Verantwortung, die mit all dem einhergeht. Dabei ist es längst nicht mehr nur eine Frage von "kann man das machen?", sondern "sollte man das tun – und zu welchem Preis?"
Ich beobachte seit etlichen Jahren, wie tiefgreifend digitale Technologien unsere Arbeitswelt, unseren Alltag und letztlich auch unsere lokalen Strukturen verändern, angefangen mit Virtualisierung, Consumerisation der IT, z.B. durch das iPhone, Cloud-Technologien und nun ist die sogenannte Künstliche Intelligenz dran. Und ich meine nicht nur die Frage, ob ich meine Daten freiwillig an chinesische oder US-Konzerne abgebe oder nicht. Es geht um mehr: um faire Arbeitsbedingungen ( auch in der Lieferkette), um digitale Souveränität, die diesen Namen verdient, und um das (überhaupt nicht) ganz banale Thema Steuern – also wer hier eigentlich noch Infrastruktur finanziert, wenn alles digitalisiert ist.
Digitale Ethik ist für mich kein Luxusthema für Akademiker, sondern ein praktisches Pflichtprogramm für alle, die mit täglich mit IT zu tun haben, ob als Kunden/Konsumenten, Dienstleister oder Hersteller. Gerade weil die Technologien, mit denen wir arbeiten, so mächtig, skalierbar und intransparent sind, müssen wir uns fragen: Wer trägt eigentlich wofür Verantwortung? "Ich bediene nur den Markt" ist ein miserables Argument für Hersteller und Dienstleister, ebenso wie "Ich kaufe das was am Besten/am Billigesten" oder "Ich habe ja keine Auswahl" vorgeschobene Argumente des Verbrauchers/Kunden sind.
Die Antwort liegt aber nicht nicht bei einer Einzelperson, einem Unternehmen oder einem Gesetzgeber allein. Die Verantwortung verteilt sich und genau darin liegt das Problem: das berühmte "Many Hands Problem" welches wir im Kleinen ja in unseren Unternehmen, ja manchmal sogar in unseren Familien sehen. Wenn jeder ein bisschen Verantwortung trägt, fühlt sich oft niemand wirklich zuständig, das Problem bleibt liegen, alle sind erstaunt und erbost, wenn uns dies dann auf die Füße fällt. Und das ist, ehrlich gesagt, der sicherste Weg in die gemeinschaftliche Verantwortungslosigkeit.
Deshalb braucht es einen Perspektivwechsel. Statt Effizienzmaximierung um jeden Preis, braucht es mehr Rückgrat und Bewusstsein dafür, dass echte Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch (das sollte inzwischen bei allen angekommen sein) , sondern auch digital und sozial gedacht werden muss. Und manchmal bedeutet das eben auch: nicht das "beste" Angebot zu wählen sondern das ethisch vertretbarste, auch wenn es ggf. teurer und weniger "feauture-complete" ist.
In den folgenden Abschnitten möchte ich darlegen, wie sich Verantwortung in der digitalen Welt konkret auf drei Ebenen aufspannt:
- Wie wir mit lokalen Arbeitskräften und Anbietern umgehen,
- wie wir digitale Souveränität sichern, und
- wie lokale Steuergelder dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
Und ich verspreche: Es bleibt nicht theoretisch.
2. Die Verantwortung von Konsumenten – mehr als nur bewusster Konsum

2.1 Für lokale Arbeitskräfte: Mit dem Einkauf fängt’s an
Die Entscheidung, wo und was wir kaufen, ist keine Nebensache – sie ist politisch. Jeder Klick im Online-Shop, jedes neue Abo, jedes Stück Hardware sendet ein Signal: Unterstütze ich faire Arbeit oder nehme ich billigend in Kauf, dass irgendwo jemand unter schlechten Bedingungen schuften muss?
Wer lokal einkauft, stärkt nicht nur die Wirtschaft vor Ort. Das Geld bleibt in der Region, sichert Arbeitsplätze, zahlt Steuern, finanziert Schulen, Straßen und Krankenhäuser. Kurz: Es macht einen Unterschied und dies direkt vor der eigenen Haustür.
Und ja, es ist manchmal teurer. Und nein, nicht jeder hat immer die Wahl. Aber wer sie hat, sollte sie nutzen. Je öfter wir uns für faire und lokale Alternativen entscheiden, desto größer wird der Druck auf Anbieter, ihre Lieferketten sauberer zu gestalten. Angebot folgt Nachfrage – auch in Sachen Ethik.
2.2 Für digitale Souveränität: Komfort ist keine Entschuldigung
Wer kennt es nicht? Ein Klick bei Google, ein neuer Account bei Amazon, alles bequem, alles synchronisiert. manchmal sogar Compliance Out Of The Box. Aber genau diese Bequemlichkeit hat ihren Preis – und zwar unsere digitale Selbstbestimmung. Wenn wir nur noch in geschlossenen Ökosystemen leben, geben wir Kontrolle über unsere Daten und Entscheidungen ab.
Digitale Souveränität bedeutet: selbst bestimmen, welche Dienste ich nutze, wie mit meinen Daten umgegangen wird und ob ich meine digitale Identität nicht doch lieber auf europäischen Servern belasse. Das ist nicht paranoid, das ist klug.
Privatsphäre ist kein verstaubtes Konzept, sondern Grundvoraussetzung für Freiheit. Wer Dienste nutzt, die mit Daten achtsam umgehen, setzt ein Zeichen – und stärkt Anbieter, die sich um Datenschutz bemühen. Und ganz ehrlich: Ein bisschen weniger Komfort ist ein fairer Preis für mehr Selbstbestimmung.
2.3 Für lokale Steuergelder: Der Hyperscaler zahlt nicht für deinen Gehweg
Klingt hart, ist aber wahr: Wer bei globalen Plattformen einkauft oder Services konsumiert, die ihre Gewinne in Steueroasen verschieben, darf sich nicht wundern, wenn die Straße vorm Haus bröckelt. Steuern finanzieren unser Gemeinwesen – und wenn sie fehlen, merken wir das alle.
Wenn ich mein Geld lokal ausgebe, profitieren nicht nur Händler, sondern auch die Kommune. Denn lokale Unternehmen zahlen hier Steuern, schaffen hier Jobs, investieren hier in Infrastruktur. Das ist keine Romantik, das ist volkswirtschaftlich sinnvoll. Und: Es ist gelebte Verantwortung.
3. Verantwortung von Dienstleistern – Cloud mit Haltung, nicht nur mit Uptime
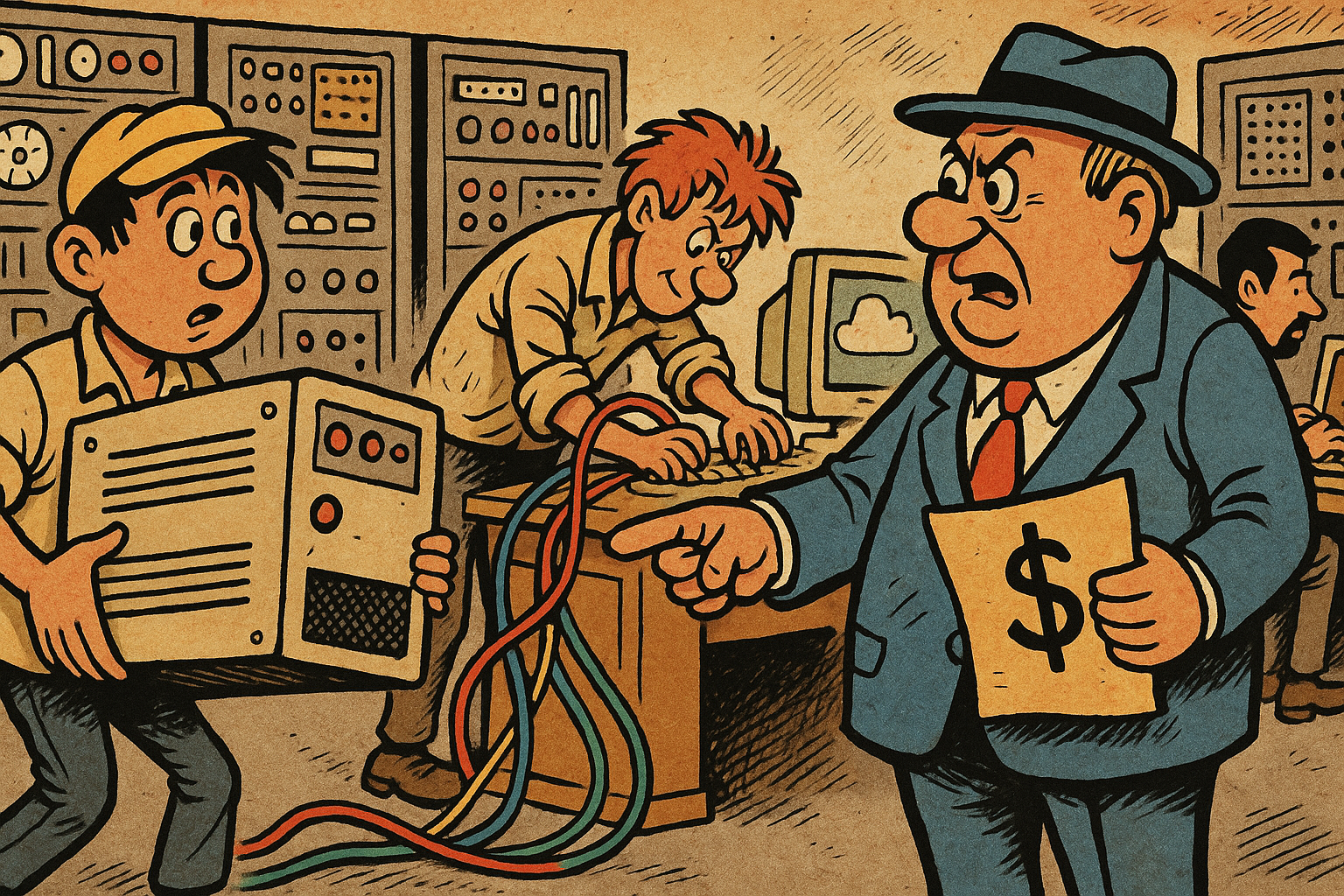
3.1 Lokale Arbeitskräfte: Outsourcing darf kein Freifahrtschein sein
Klar, IT-Dienstleister stehen unter Druck: Fachkräftemangel hier, steigende Kosten dort. Aber daraus blindes Offshore-Outsourcing zu machen, ist keine Lösung – zumindest keine ethisch vertretbare. Wenn Entwicklungsteams in Europa abgebaut und durch billigere Kräfte in anderen Kontinenten ersetzt werden, spart das kurzfristig Geld, aber langfristig verliert man nicht nur Kompetenz, sondern auch Vertrauen. Und spätestens ein paar Jahre später wird wieder über den (selbstgemachten) Fachkräftemangel gejammert.
Lokale Arbeitsplätze sind nicht nur ein Kostenfaktor, sie sind das Rückgrat eines funktionierenden digitalen Ökosystems. Wer lokal investiert, in Ausbildung, in faire Arbeitsbedingungen, in nachhaltige Infrastruktur, stärkt nicht nur sein eigenes Unternehmen, sondern auch die Region und die langfristig! Und übrigens: Es gibt sie, die Positivbeispiele. Anbieter wie Infomaniak, Datagroup, Wortmann, IONOS und viele mehr zeigen, wie es geht. Lokal, nachhaltig, verantwortungsvoll.
3.2 Digitale Souveränität: Der CLOUD Act liest mit
Das Schlagwort „digitale Souveränität“ wird gern auf Konferenzen bemüht – aber selten wirklich durchdekliniert. Fakt ist: Wer Dienste von US-Providern nutzt, muss sich bewusst sein, dass der CLOUD Act US-Behörden Tür und Tor öffnet – selbst bei Daten, die physisch in Europa liegen. Dies musste in einem peinlichen Moment auch der Chefjustiziiar von Microsoft Frankreich vor dem französischen Senat zugeben.
Das klingt nicht nur nach einem hypothetischen Datenschutzproblem – das ist eines. Es untergräbt das Vertrauen in digitale Infrastruktur. Deshalb braucht es souveräne Cloud-Lösungen, am besten betrieben von europäischen Unternehmen mit offenen Standards und echtem Datenschutz. Gaia-X und CISPE (wenn man sich von unpassenden Mitgliedern trennt) oder IONOS sind gute Ansätze – aber sie müssen zur Regel, nicht zur Ausnahme werden.
3.3 Lokale Steuergelder: Wer hier Geld verdient, soll auch hier zahlen
Digitale Dienstleistungen sind oft gefühlt grenzenlos, ihre Steuerzahlungen leider nicht. Globale Cloud-Giganten schaffen es regelmäßig, ihre Gewinne so zu verschieben, dass am Ende wenig bis gar nichts in der lokalen Kasse landet – obwohl sie hier Infrastruktur nutzen, Mitarbeiter beschäftigen oder Kunden bedienen.
Transparente Steuerpraxis sollte keine Ausnahme, sondern Mindestanforderung sein. Und ja: Auch digitale Dienste lassen sich lokal betreiben, versteuern und kontrollieren – man muss nur wollen. Regionale Anbieter tun das bereits. Sie zahlen Steuern dort, wo sie tätig sind, schaffen Arbeitsplätze vor Ort und investieren zurück in die Region. Genau das brauchen wir – gerade im digitalen Raum.
4. Verantwortung von Herstellern und Programmierern - Zwischen Platinen, Code und Prinzipien

4.1 Lokale Arbeitskräfte: Wer billig produziert, zahlt woanders drauf
Wer einmal in die Lieferketten moderner IT-Hardware geschaut hat, weiß: Hier geht es nicht nur um Technik, sondern oft auch um Ausbeutung. Überstunden, unsichere Arbeitsbedingungen, Dumpinglöhne – vieles davon steckt in unseren Geräten. Und das, obwohl längst bekannt ist, wie man es besser machen könnte.
Fair Trade ist kein Fremdwort, auch nicht in der IT. Hersteller wie Fairphone, Tuxedo, Why! oder auch Intel, die sich zur Einhaltung internationaler Arbeitsstandards bekennen, zeigen: Es geht. Nur: Es kostet eben auch mehr. Und genau hier liegt das Dilemma – solange wir als Markt nur den billigsten Preis belohnen, wird sich wenig ändern.
Outsourcing in Länder mit niedrigen Löhnen mag betriebswirtschaftlich clever erscheinen. Doch ethisch betrachtet ist es ein Spiel mit ungleichen Karten. Es geht nicht darum, internationale Zusammenarbeit zu verteufeln. Aber: Wenn das Lohngefälle systematisch ausgenutzt wird, um Margen zu maximieren, dann läuft etwas schief und zementiert diese Ungleichheiten. Und eben dies müssen wir als Branche offen benennen – und korrigieren.
4.2 Digitale Souveränität: Ohne offene Standards wird’s eng
Viele öffentliche Einrichtungen, Kommunen und sogar ganze Staaten sind heute abhängig von einigen wenigen Tech-Giganten, meist unfreiwillig. Proprietäre Formate, fehlende Schnittstellen, unklare Lizenz-Modelle: Das alles macht Wechsel schwer bis unmöglich. Die Folge: ein digitaler Lock-in, bei dem man sich nicht mehr selbst helfen kann und dafür auch noch bezahlt.
Open Source ist hier mehr als nur eine technische Option – es ist eine politische Entscheidung für Unabhängigkeit. Plattformen wie openCode oder openDesk, Unternehmen wie SUSE oder Canonical, aber auch die Beiträge von Google zu Kubernetes & Co. zeigen: Offenheit funktioniert. Und sie schafft Innovation, die nicht exklusiv, sondern inklusiv ist.
Digitale Souveränität fängt bei Software an, hört aber bei Hardware nicht auf. Das „Recht auf Reparatur“, das endlich konkrete Formen annimmt, ist ein wichtiger Schritt. Wer Ersatzteile zurückhält oder Reparatur verhindert – sei es per Software-Blockade oder Designtrick – handelt nicht nur kundenfeindlich, sondern unsouverän. Und das sollte in Europa keinen Platz mehr haben.
4.3 Lokale Steuern: Gewinne ohne Gemeinwohl?
Dass große Digitalkonzerne ihre Gewinne dorthin verschieben, wo die Steuerlast am kleinsten ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch nur weil es legal ist, heißt das nicht, dass es legitim ist. Denn das Geld fehlt dort, wo es gebraucht wird: in Schulen, bei Rettungsdiensten, in digitaler Infrastruktur. Hat hier jemand Glasfaserausbau gesagt?
2024 wurde endlich ein globaler Mindeststeuersatz eingeführt. Ein Anfang – aber eben nur das. Was fehlt, ist der Mut, sich gegen Steuervermeidung klar zu positionieren. Hard- und Softwarehersteller, die Millionen verdienen, aber kaum etwas zum Gemeinwesen beitragen, schwächen das Fundament, auf dem ihr Erfolg überhaupt erst möglich wurde.
Und bitte kein Whataboutism: Auch kleinere Anbieter müssen sich anständig verhalten – aber wenn die Großen sich systematisch wegducken, ist das nicht nur unfair, sondern gefährlich.
5. Fazit und Empfehlungen – Zwischen Haltung und Handlung
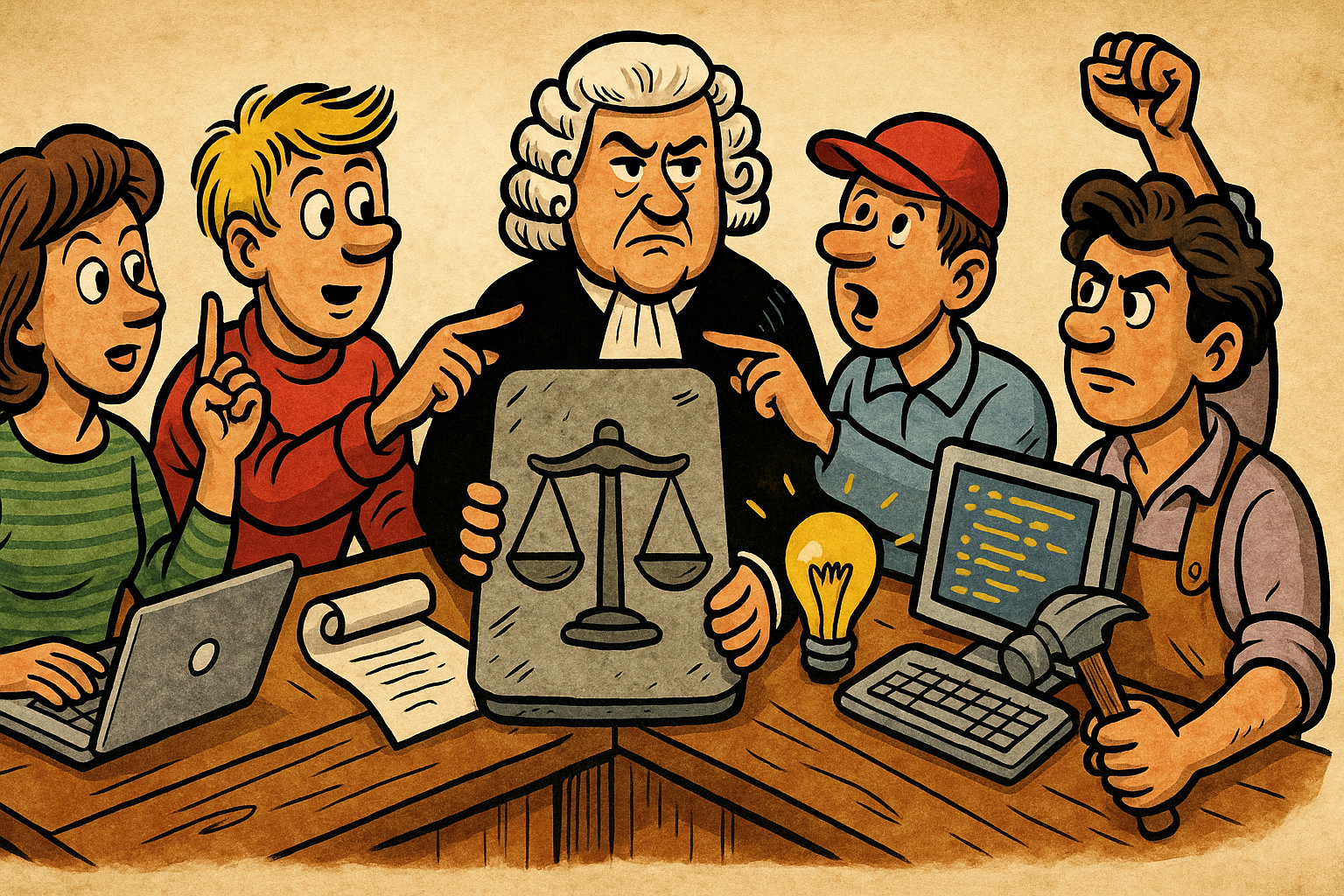
Die letzten Zeilen zeigen hoffentlich eines: Ethische IT ist kein Randthema. Sie betrifft uns alle – egal ob wir kaufen, programmieren, hosten oder gestalten. Und es reicht nicht, sich auf gesetzliche Mindeststandards zurückzuziehen oder auf einzelne Leuchtturm-Initiativen zu hoffen. Wir brauchen mehr.
Mehr Verantwortung. Mehr Rückgrat. Mehr Mut, auch mal bewusst nicht das billigste, schnellste oder bequemste Angebot zu wählen – sondern das richtige.
Konsumenten entscheiden jeden Tag mit ihren Klicks, was sie fördern: Ausbeutung oder Fairness, Datenschutz oder Datenhandel, lokale Wirtschaft oder globale Steuervermeidung.
Dienstleister müssen sich ehrlich fragen, ob die Cloud(s) ihrer Wahl wirklich souverän sind, ob sie wirklich die richtige Beratung für den Kunden erbringen 8oder die opportune) , ob ihre Mitarbeiter fair bezahlt werden – und ob sie nicht mehr tun könnten, als nur Services bereitzustellen. Aufklärung über all diese Punkte zum Beispiel.
Hersteller und Programmierer tragen Verantwortung für faire Lieferketten, offene Standards und ein Steuermodell, das dem Gemeinwohl dient, nicht nur dem Shareholder Value wie es Broadcom so erfolgreich vormacht.
Und Politik und Regulierung? Obwohl ich kein Freund von Regulierung bin geht es meiner Meinung nach leider nicht mehr anders. Sie müssen endlich die Spielregeln so setzen, dass Fairness der neue Standard ist und nicht die Ausnahme.
Konkrete Empfehlungen – weil Moral auch Hand und Fuß braucht
Für Kunden/Konsumenten:
- Bewusst kaufen. Nicht nur grün gewaschen, sondern echt fair.
- Lokal denken, lokal zahlen – weil der Gehweg sich nicht von selbst repariert.
- Datenschutz nicht als Nice-to-have, sondern als Voraussetzung begreifen.
Für Dienstleister:
- Lokale Infrastruktur stärken. Menschen einstellen, nicht nur Maschinen skalieren.
- Cloud souverän denken – ohne US-Zugriffsrechte und mit europäischem Rückgrat.
- On- und Re-Shoring statt Near- und Farshoring!
- Steuertransparenz leben, nicht nur fordern.
- Den Lieferanten nicht nach Preis - sondern nach seiner (lokal erbrachten) Leistung wählen
Für Hersteller und Programmierer:
- Lieferketten ernsthaft prüfen, nicht nur Zertifikate kaufen.
- Reparierbarkeit nicht blockieren, sondern ermöglichen und fördern.
- Open Source nicht als Feigenblatt, sondern als strategische Entscheidung sehen.
Für Politik und Regulierer:
- Steuervermeidung eindämmen. Global und lokal.
- Faire Arbeit in der Lieferkette verbindlich machen – nicht nur empfehlen.
- Digitale Bildung und Mündigkeit fördern, statt auf die Eigenverantwortung zu hoffen.
- Open Source Produkte in der Beschaffung präferieren
- Open Source fördern - "Public Money = Public Code!"
Zusammengefasst: Digitale Verantwortung beginnt nicht im Silicon Valley. Sie beginnt hier. Bei uns. In unseren Büros. In München. In Berlin. In Montabaur. In Genf. In Hüllhorst. Jeden Tag.
Danke fürs Lesen. Und vielleicht auch fürs Umdenken.